Introduction: Shelley Frisch on Translating Peter Neumann’s Jena 1800
Back in the 1970s, when I wrote my dissertation on a theme relating to Early German Romanticism, I would not have imagined that someday I might translate a book on this topic as magnificent as Peter Neumann’s Jena 1800, one that would read so engagingly and tell such a compelling story of the group that came together in the university town of Jena and set the course of intellectual, cultural, and literary theory and practice for the early years of the nineteenth century and beyond. And now, here it is in print, a book that Publishers Weekly is describing as “an invigorating aperitif [that] will whet readers’ appetites for diving into the deep end of 18th- and 19th-century German philosophy.” Early reviewers have praised its “light, fast-paced clarity … [in which] German intellectual history comes to life in quick, bold passages [and] lets the reader feel the romance of philosophical insight” (Daniel Purdy), and its “lively, impassioned, and entertaining telling of the lives and ideas of a group of distinguished and up-and-coming German philosophers, poets, and intellectuals” (Gabriel Gottlieb). Claire Messud, in the latest Harper’s, chimes in in a similar vein: “It’s an exhilarating account of a remarkable historical moment, in which characters known to many of us as immutable icons are rendered as vital, passionate, fallible beings.” It may go without saying that none of the adjectives lauding this sparkling presentation would have applied to the dutiful dissertation that capped my graduate studies in the previous millennium.
The brief excerpt reprinted here is a snapshot of the daily lives of the group of young literary intellectuals who lived at Leutragasse 5 in Jena, the meeting point for a large circle of leading thinkers of the era. In this passage we learn of Friedrich Schlegel’s crippling writer’s block as he churns out the second part of his novel Lucinde, a paean to the union of sensual and spiritual love that was considered revolutionary in its time. The residents featured here are Friedrich (“Fritz”) Schlegel, an innovator in the fields of literature, philosophy, philology, and Indology; his partner Dorothea (née Mendelssohn (daughter of philosopher Moses Mendelssohn and aunt of composer Felix Mendelssohn and musician Fanny Mendelssohn), then Veit, then Schlegel), a novelist and translator; Friedrich’s brother August Wilhelm (“Wilhelm”) Schlegel, a poet, translator, and critic; and Wilhelm’s partner Caroline (née Michaelis, then Böhmer, then Schlegel, then Schelling), a noted intellectual and book critic.
My translation of this passage is accompanied by two passages from Peter Neumann’s original German book to show how that book matches up with the translation. Readers will notice that the English-language text appears in an order quite different from that of the source text. Peter Neumann, the author, Julia Ringo, our Farrar, Straus & Giroux editor par excellence, and I realigned the text throughout to ensure that English-language readers, who are likely to be less well acquainted with its dramatis personae, could follow the development of its many and varied characters. I have included the two sections of the German original that most closely mirror the narrative of the translation. No textual elements have been sacrificed in the translation, but a good many have been shifted among the different chapters.
Princeton, New Jersey / January 2022
» » »
The Most Beautiful Chaos: Lucinde, or The Audacity of Love
When Dorothea finally arrived to meet Fritz in Jena in late 1799, she found her lover in an almost pathological state of melancholy. His worries about the progress of his work were eating him up. Sometimes he sat there, barely responsive, propping up his head with his elbows, his thumb and index finger drawing slow circles toward each other down from his forehead, then between his eyes to the tip of his nose. At some point he would glance at whatever English-language book Wilhelm was translating at the moment, usually Shakespeare; Henry IV lay on the desk just then. A few moments later his fixed gaze would reveal that once again he had been unable to get himself to write. He’d return to propping up his head and rubbing his temples in a constant circling motion before he flopped down on the sofa in exhaustion. Dark thoughts, troubled sleep. There was nothing Dorothea could do.
The trip to Jena had been sheer torture. Fritz had headed off from Berlin in early September, but she had stayed behind for a few more weeks in order to see to custody arrangements for Philipp, her son from her first marriage. By the time she set out on the journey, the streets were almost impassable. Several times the coach got stuck, and the travelers had to get out in the rain so the horses and carriage could move again. At one point the two horses in front sank so deep in the mud that it took hours to free them up, with the aid of farmers who were summoned to help. It went on like this day after day.
Dorothea had often imagined their reunion. As she lay awake through long nights, writing letter after letter to Fritz, she pictured the carriage approaching the city, Jenzig Mountain in the background standing out in sharp relief, next to it the tower of Saint Michael’s Church; her mind’s eye moved across the placid valley and the city, a grand panorama that she, a city girl from Berlin, found moving yet almost intimidating, both sublime and sweet. Then she envisioned herself traveling across the river, turning onto the street where she would step out of the carriage, hearing one last snort from the horses, and see Fritz coming down the stairs, slowly, as though he were not the least bit eager to hold her in his arms again after not having seen her for so long, and Wilhelm, too, would appear in the doorway with Caroline, the sister-in-law she was eager to win over, and whom she had known only from letters up to this point. This was to be more than a reunion; it would be the moment that knitted the family together. And now, with Fritz’s despondency, things had taken an unexpected turn.
Dorothea and Fritz had stood by each other; that was not the problem. Leaving Berlin had been the right thing to do. But Dorothea could tell that something was holding him back, though she could not bring up the subject. Wilhelm finished a poem every morning, and all the others were making progress on their projects. Ludwig Tieck was now writing a drama, Genoveva, which he hoped he could soon present to the master, Goethe, and she herself, Dorothea, was working on her new novel, yet Fritz grew gloomier with each passing day. And there was not even any decent wine to be had.
One evening, Fritz was writing in terza rima, and every time he jotted down a verse, he would dash out of his attic room and down into the parlor, a full three flights, two steps at a time, then stand before her breathlessly, as though he’d been stung by a wasp. Dorothea did not know what to make of his behavior. She liked the verses—no doubt about that — but the way he was carrying on … Fritz, who was under tremendous pressure, snarled at her that the second part of Lucinde had to get done. He would face dire consequences if he proved unable to complete the project he had laid out for himself.
*
The first part of Lucinde had heralded a literary revolution. Just as the concluding portion of Schiller’s Wallenstein trilogy — Wallenstein’s Death — was premiering in Weimar in the spring of 1799, staged by Schiller himself and directed by Goethe, Fritz’s novel was published, and it was far more fanciful than his contemporaries could have anticipated. Schleiermacher claimed that at any moment the book could disintegrate into its component parts, yet it constantly came together again, “as though from a future world that is God knows how far away.”
Many forms converged in this novel: letters, dialogues, aphorisms, diary entries. Lucinde burst open literary genres from within, reached for the “most beautiful chaos,” and wound up turning into an “aesthetic monstrosity,” in the view of some critics — while others hailed the novel, which resisted pigeonholing as such, for its formal and linguistic originality. And while Schiller’s Max Piccolomini throws himself into a hopeless battle against the Swedes, which ends up costing him his life, Schlegel’s male protagonist, Julius, who is head over heels in love with his female counterpart, takes up the fight for his love, ultimately invoking the motto “Even though this world may not be the best or most useful, I still know that it is the most beautiful,” before succumbing to his passion.
Lucinde is about love, a topsy-turvy reenvisioning of time that outmaneuvers attempts to rein in the moral order and leaves morality behind by invoking aesthetic intuition, overcoming even the distance between partners through dreams, fantasies, and imagination. Julius is the lover and writer; Lucinde, the lover and nonconformist. The plot is minimal; the novel revolves solely around the couple’s discovery of love as a way of life that subverts traditional patterns, highlighting the eternal duality of devotion and fidelity, friendship and marriage, elation and abstinence.
Gender relations are inverted, and the irreconcilable polarity of man and woman falls away. In Schlegel’s view, overblown femininity and exaggerated masculinity were both one-sided, tedious, and backward-looking. The genders ought to complement each other and form one gender, namely, that of the human being; there should be no other. No more male domineering aggressiveness and female selfless devotion. The contrasts needed to be balanced out. Julius’s conclusions are as radical as can be: “I can no longer say ‘my love’ or ‘your love’; the two are identical and perfectly united, as much love bestowed as requited.”
Caroline was excited as she relayed her first impressions of the novel to Novalis. What could this book be compared to? All of it clashed with conventional notions about marriage, established forms of relationships, decency, and propriety. Love had no use for external structures; it was the form of life itself. Love and morality, commitment and fidelity did not need to be regarded as true opposites, as long as each was regarded in correlation with the other. Caroline thought that the witty novels of the humorist Jean Paul might be raised in comparison, but Lucinde couldn’t be compared to those either — nothing at all could be compared to the work of the singular writer Jean Paul. As Caroline had recently learned in a conversation with Fichte’s prim and proper wife, even he had read the novel three times already, and found that it got better each time.
It was beside the point that Fritz’s novel bore autobiographical characteristics, that Fritz was easily recognizable in the character of Julius, and Dorothea — or even Caroline — in the character of Lucinde. Instead of authenticating the written text by comparing it to reality, readers needed to recognize that the writing itself infused reality, thus becoming the reality in need of this infusion.
The consequence of the ingenious game Fritz Schlegel played with his readers was unending bafflement, confronted as they were by one cascade of genitives after another; like a mirror image lost in its own mirror image, the reader’s reflection was steered into the depths of the text, and there one came upon a novel that essentially contained itself. That was precisely Schlegel’s strategy, because it revealed something essential about reality — that it, too, was rarely as clear-cut as people thought, and it, too, sometimes started to flicker, to oscillate nervously between the extremes.
Backlash from smug, prissy Berlin was inevitable. The novel seemed like a foreign substance invading the fusty decorum of the salons of Berlin. It was received as shameless, “filthy nonsense.” Even Schiller stabbed Fritz in the back, panning the book as the “height of modern formlessness and affectation.” It had clearly hit a nerve. Only a moribund era, even one that held its critical faculties in such high esteem, would react this way. Fritz had zoomed far ahead of his era, as he himself knew. Perhaps the novel should not have appeared in print at all, or at least not at the time. Fifty years hence, it might have been read as a novel that would make readers wish it had been published fifty years earlier. The vehemence with which reactions came swirling at Fritz proved to him that he was on the right track, yet he could not shake the feeling that he might lose his mind on the quest to complete the second part.
*
The city may not have been beautiful, but at least Dorothea had arrived. Money was tight, and the gender roles were not on as equal a footing as she had hoped: while Fritz and Wilhelm worked during the day, she ran the household with Caroline, tended to Philipp and Gustel, and took care of the house and the guests. The house also needed a good spring cleaning. She seldom found time for the finer things in life. Caroline took an active role in Wilhelm’s Shakespeare translations, reviews, and essays, and Dorothea forged ahead on her first novel, to be called Arthur. At least she was receiving monthly financial support from Simon Veit, her ex-husband, but she had come away from her marriage to him with only a small number of possessions — including her piano — and those had been left behind in Berlin. Now she needed to be thrifty.
Veit, the banker she had married in 1783 at the age of eighteen, had made for a respectable match. Having bankers in the family had become somewhat of a tradition. Her mother, Fromet, was born into the Guggenheim merchant family of Hamburg; her ancestors included influential Viennese bankers, notably Samuel Oppenheimer, who handled royal finances. Her father, the famous philosopher Moses Mendelssohn, had arranged for the union when she was fourteen years old. The marriage was devoid of heart and spirit. Veit, a dull, calculating, uneducated man, talked only about business. There could be no comparison to the far more quick-witted man, some twenty years younger, with whom she had now decided to share her life. Luckily, Simon and Dorothea were able to come to an agreement: he left their son in her care, and paid alimony. She was granted custody on the condition that she would not turn her back on the Jewish faith.
Dorothea lived happily with Philipp in her new residence at Leutragasse 5 and felt that she was getting smarter and more skillful by the day. She loved that their new home was full of quirky individuals who looked down on the neighbors who avoided them, considering them philistines. She didn’t care. No one who was not privy to her new household’s inner circle could imagine the plethora of wit and poetry, art and science surrounding her.
Still, there was no lack of friction. Alliances were forged, philosophical concepts torn apart, prickly remarks bandied about. When it came to Caroline, Dorothea held back. She noticed that Wilhelm’s wife had been sizing her up from the very first day, no matter how much kindness Caroline displayed openly. Dorothea was short — much shorter and wider than Caroline. When Dorothea looked in the mirror, she often concluded that she was not pretty: her eyes were big, quite reddened, even somehow burning, her face haggard and hardened. Sometimes she wished she had some of the “lordly audacity” with which Caroline — the admirable hostess, art critic, shining light in every way—pulled off their lunch gatherings as though she had been doing it all her life, without a trace of arrogance. Kant, who had recently been the subject of conversation at the lunch table, as he often was, called behavior like theirs “unsocial sociability,” by which he meant a kind of natural antagonism that inhered in human coexistence, a chaotic mixture of conflicting interests. Kant explained that on the one hand, man is predisposed to associate with others, “because in these kinds of circumstances he feels he is more than man, that is, more than the development of his natural capacities,” but on the other he also strives for isolation, “because he also finds within himself the unsocial characteristic of wanting everything to go solely to his liking.” And this was where conflict originated: friction in social interaction, a resistance that, despite a certain element of tragedy, had something altogether positive about it, because it exerted a disciplining, tempering, and cultivating effect. People needed to realize that they needed their fellow men to achieve their goals, even if they strongly disliked those fellow men, for, sooner or later, one’s goals would no longer be individual but common. And in this way, Kant concluded dialectically, “the first true steps [are taken] from barbarism to culture.”
Dorothea, Caroline, Fritz, and Wilhelm made a pact to call themselves Symmenschen (“sym people”) as part of a set of coinages to refer to those who were highly adept, jointly and individually, at both symphilosophieren (philosophizing as a group) and symfaulenzen (idling as a group). And even though Wilhelm still had a restless, rash way about him, of which Fritz felt he needed to be cured, the group collectively embodied a higher unity, which they aimed to fight to maintain in the future. Caroline and Wilhelm, Dorothea and Fritz had no choice but to embrace the opportunity to form this higher unity. It was a good thing that they had decided to reject the idea of sharing a household with Fichte in Berlin that summer. If German literature, which still lagged so far behind other national literatures, were to be moved into the revolutionary mode in which someone like Fritz would like to see it, they would have to effect such a change there, in Jena, together.
* * * * *
Schön ist die Stadt nicht, aber Dorothea ist angekommen, Jena ist ihr neues Zuhause. Die Finanzen sind nicht üppig und ganz so gleichberechtigt, wie sie am Anfang gehofft hat, geht das Leben im Haus der Leutragasse dann doch nicht zu: Während Fritz und Wilhelm tagsüber arbeiten, besorgen Caroline und sie den Haushalt, versorgen Philipp und Gustel, verköstigen das Haus und die Gäste: bei der großen Anzahl und hohen Frequenz von Besuchen keine geringe Aufgabe. Zeit für Eigenes bleibt nur dazwischen: Caroline beteiligt sich rege an den Shakespeare-Übersetzung Wilhelms, arbeitet an Rezensionen und Abhandlungen mit, Dorothea schreibt unbehelligt an ihrem Erstling weiter, »Arthur« soll er heißen, übernimmt kleinere Aufträge gegen Geld. Sie hofft auf diese Weise etwas zum häuslichen Budget beitragen zu können. Im Grunde lebt sie von einer Pension, die ihr Simon Veit, ihr geschiedene Ehemann, monatlich hinterlässt. Viel hat sie aus der Ehe mit dem Bankier Veit nicht gerettet, außer ein paar Habseligkeiten, zu denen auch ihr Klavier gehört, das sie in Berlin zurücklassen musste. Sie muss sparsam sein, und ihren Sohn Philipp, den gibt es ja auch noch.
Was Caroline angeht, bleibt Dorothea skeptisch. Bei aller Freundlichkeit, die sie an den Tag legt, merkt Dorothea, dass sie vom erstenTag an genauestens von Caroline gemustert wird. Dorothea ist klein – viel kleiner und breiter als Caroline. Oft findet sie, dass sie gar nicht hübsch aussieht, wenn sie in den Spiegel schaut: die Augen sind groß, stark gerötet, irgendwie brennend, das Gesicht abgespannt und verhärtet. Die Stimme ist noch das sanfteste an ihr. Auch ihre Kleider sind nicht elegant. Aber wer ist das schon in diesem Haus, dafür fehlt das Geld. Manchmal, da wünscht sie sich etwas von der »edlen Dreistigkeit«, mit der Caroline die Mittagsrunden schmeißt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Caroline, die bewundernswerte Gastgeberin, Kunstkritikerin, Alleskönnerin. Von Arroganz keine Spur. Bis hier und da wieder etwas von ihrer Capricen- und Launenhaftigkeit zwischen zwei Sätzen durchscheint. Insgesamt verträgt man sich aber gütlich, kommt bestens miteinander aus. Man will den Burgfrieden wahren und weiß sich am Ende des Tages »dernier bien«.
Das Haus, und das liebt Dorothea so sehr an diesem Leben in Jena, steckt voller Originale, auch wenn es immer mehr Leute gibt, die sich pikiert von ihnen abwenden, Philister. Im Grunde sieht man nicht viel mehr als diejenigen Menschen, die mittags zu Besuch kommen. Hier in Jena ist so gar nichts vorhanden vom großbürgerlichen Ambiente der preußischen Hauptstadt. Schleiermacher, mit dem man brieflich in Kontakt steht, gemeinsam korrespondiert, ist einer der letzten verbliebenen Kontakte ins pulsierende Leben der Berliner Salons. Ihr soll es gleich sein. Hier, wo sie lebt, steht ein jeder seinen Mann. Die ›schöne Geselligkeit‹, die sie versuchen als Modell zu leben, ist ein ungeheurer Kraftakt. Immerhin: In der ersten Zeit, die Dorothea nun hier ist, hat sie noch kein einziges Wort gehört, dass ihr eine unangenehme Empfindung bereitet hätte. Ab und zu, da gibt es einen lächerlicher Auftritt, mag sein, aber das geht vorüber. Es vergeht wirklich kein Tag, an dem sie nicht die schönsten Dinge hört, sieht und von den anderen erfährt. Dorothea lebt vergnügt in ihrem neuen Domizil in der Leutragasse und glaubt, alle Tage klüger zu werden und geschickter.
Und wer es sollte es auch nicht bei diesen Menschen. Ein solches »ewiges Concert von Witz und Poesie, und Kunst und Wissenschaft«, das Dorothea in diesem Kreis umgibt, kann sich ohnehin nur der vorstellen, der dabei gewesen ist, und wer dabei gewesen und davon unberührt geblieben ist, der muss entweder aus Eisen sein oder aus Stein oder ganz und gar tot. Man vergisst die ganze übrige Welt darüber, und das, was die übrige Welt so ihre Freuden und ihre Schmerzen nennt.Manchmal, da holt Dorothea wieder Berlin ein: ihr altes Leben, Simon Veit, die Mendelssohns, die jüdische Gemeinde. Aber sie weiß, dass kein Weg mehr dahin zurückführt, dass ihr Leben jetzt in eine offene, ganz und gar unbestimmte, aber auch freie Zukunft weist. Sie, Caroline, Fritz und Wilhelm haben einen Pakt geschlossen, sie nennen sich »Symmenschen«, sie können ebenso gut miteinander ›symphilosophieren‹ wie sie miteinander »symfaulenzen« können, alles gemeinsam, jeder für sich. Und auch wenn Wilhelm immer noch so eine »unruhige hastige Art« hat, die man ihm, wie Fritz einmal am Mittagstisch gemeint hat, unbedingt abgewöhnen müsse, verkörpern sie zusammen eine höhere Einheit und wollen darum streiten, jetzt und für immer.
Kant, über den man erst neulich am Mittagstisch gesprochen hat, nennt so etwas »ungesellige Geselligkeit« und meint damit den Antagonismus der Natur in der Gesellschaft. Nach Kants Vorstellung ist das gesellschaftliche Zusammenleben von Konflikten durchdrungen, die soziale, kulturelle und politische Sphäre, ein hochfrequentierter Kampfplatz unterschiedlicher Interessen. Der Mensch, so sagt Kant, habe einerseits eine Tendenz sich zu vergesellschaften, »weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. die Entwickelung seiner Naturanlagen fühlt«. Das ist die eine Seite der Medaille. Andererseits habe der Menschen aber auch eine Tendenz sich zu vereinzeln, »weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen«. Und eben hieraus entsteht der Konflikt, die Reibung im gesellschaftlichen Umgang, ein Widerstand, der, bei aller Tragik die ihn zuweilen begleitet, auch etwas überaus positives an sich hat: Denn durch den Konflikt hindurch findet eine Disziplinierung, Mäßigung und Kultivierung des Menschen statt: Der nämlich muss einsehen, dass er von seinen Zeitgenossen, auch wenn er sie gar nicht leiden, im Grunde auch nicht von ihnen ablassen kann, weil er sie zu Erreichung seiner eigenen Ziele braucht, die nun über kurz oder lang auch nicht mehr seine eigenen Ziele sind, sondern zu gemeinsamen Ziele werden. Und da geschehen nun, wie Kant dialektisch schlussfolgert, »die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Cultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Werth des Menschen besteht; da werden alle Talente nach und nach entwickelt, der Geschmack gebildet und selbst durch fortgesetzte Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage zur sittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Principien und so eine pathologisch-abgedrungene Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralischen Ganzes verwandeln kann«.
Dorothea erlebt das gemeinsame Zusammenleben in der Leutragasse wie eine experimentelle Versuchsanordnung dessen, was Kant geschichtstheoretisch erläutert hat. Ein Laboratorium der Poesie. Auch und vor allem deshalb, weil bei aller Geselligkeit, die das Herz der Hausgemeinschaft bildet, die kleinen Gehässigkeiten zwischen ihnen nicht abnehmen. Weiter werden hinter dem Rücken des anderen Allianzen geschmiedet, philosophische Entwürfe zunichte gemacht, sodass selbst hier beziehungsweise gerade hier noch immer jener Antagonismus zum Vorschein kommt, der für Kant den Menschen zu dem widerspruchsvollen Wesen macht, das er de facto auch ist. Denn »aus so krummen Holz, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden«. Und ist es nicht auch Kant, dessen geschichtsphilosophische Spitze darin besteht, dass sich die Aufklärung auf dem höchsten Punkt ihrer Entwicklung gegen sich selber wendet, und zwar in dem Moment, in dem sie von ihrem eigenen Widerspruchscharakter ablässt? Caroline und Wilhelm, Dorothea und Fritz bleibt nichts anderes übrig. Die Chance ist da: Die Hausgemeinschaft mit Fichte in Berlin hat man gottlob verschmäht. Man muss es hier, in Jena, gemeinsam versuchen.
Literarische Teufeleien
Lange Zeit will es für Fritz mit der Arbeit nicht recht vorangehen. Dorothea findet ihren Geliebten zwar unbeschadet vor, als sie in Jena ankommt, Fritz aber plagt eine beinahe schon pathologische Disposition zur Melancholie. Er steckt mitten drin in einer tiefen Schreibkrise. Selten verlässt Fritz die Dachstube. Meist sitzt er da, wirkt kaum ansprechbar, und lässt, die Ellenbogen aufgestützt, Daumen und Zeigefinger langsam gegeneinander kreisen, von der Stirn abwärts bis zwischen die Augen, den fein geformten Nasenrücken hinunter bis zur Nasenspitze, von wo sie in einer langen geraden Linie in der Luft enden, während der Blick weiterhin stur ins Nichts geht. Manchmal, da fühlt er noch einem englischsprachigen Buch auf den Puls, das Wilhelm übersetzen möchte, aber wenige Augenblicke später verrät sein gelangweilter Gesichtsausdruck schon, dass es auch dieses Mal wieder ein vergebliches Unternehmen ist mit ihm, ihr zur Arbeit zu bewegen und zum Schreiben. Den Kopf hält er dann wieder aufgestützt, Daumen und Zeigefinger im Anschlag, ein unentwegtes Kreisen, bevor er sich völlig erschöpft aufs Kanapee fallen lässt. Dunkle Gedanken, unruhiger Schlaf.
Dorothea und Fritz kommen gut miteinander aus, daran liegt es nicht. Es gibt da nur etwas, das spürt Dorothea, das Fritz lähmt, auf das sie ihn aber auch nicht wirklich ansprechen kann. Während Wilhelm jeden Morgen ein Gedicht macht und auch alle anderen um ihn herum mit der Arbeit an ihren Projekten vorankommen, Tieck etwa, der neuerdings an einem dramatischen Werk schreibt, und auch sie selbst, Dorothea an ihrem ersten Roman arbeitet, »Arthur« soll er heißen, wird das Schreiben für ihn, Fritz, immer schwerer und er dadurch von Tag zu Tag betrübter. Die Sorge um das Fortkommen seiner eigenen Arbeiten frisst ihn förmlich auf, hindert ihn eher, als dass sie ihn anspornen könnte. Und dann gibt es noch nicht einmal vernünftigen Wein im Hause gibt, der gewöhnliche, den Fritz immer trinkt, kommt aus der Region Graves bei Bordeaux, einen anderen gibt es nicht. Gnade ihm Gott, sollte das Projekt, das er sich selber vorgesetzt hat, nicht gelingen. Eines Abends, da dichtet er Terzinen, und kommt für jede Terzine, die er zu Papier gebracht hat, aus seinem Zimmer in der obersten Etage nach unten in den Salon gelaufen, immerhin drei Stockwerke. Zwei Stufen auf einmal. Ganz außer Atem steht er dann jedes Mal vor ihr, in der Tür, und versucht wieder zu Luft zu kommen. Dorothea, die unten im Parterre wohnt, ist vollkommen perplex, weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Niemand ist so gequält wie Fritz, wenn ihm etwas nicht gelingt, das weiß Dorothea, aber muss es gleich so eine Szene sein? Die Verse gefallen ihr, keine Frage, das tun sie, allein der Auftritt – Fritz fährt sie regelrecht an, von Mal zu Mal mit stärkerer Intensität. Er steht unter Strom: Der zweite Teil der »Lucinde« muss fertig werden, er muss endlich gelingen.
Der erste Teil der »Lucinde« ist eine literarische Revolution. In Weimar wird gerade der letzte Teil von Schillers »Wallenstein«-Triologie uraufgeführt, von Schiller selbst inszeniert, unter Goethes Leitung, »Wallensteins Tod«, ein dichter Stoff, mühevoll historisch aufgearbeitet und dramatisch in Szene gesetzt, und Schlegel veröffentlicht ein Buch, das noch weit aus fantastischer ist, als sich es seine Zeitgenossen vorstellen können. So kühn, weil es ein Roman sein will, aber kein Roman sein kann, partout in seine Einzelteile zerfällt und aus seinen Einzelteilen wiederaufersteht, ein Werk, das »wie eine Erscheinung aus einer künftigen Gott weiß wie weit noch entfernten Welt dasteht«. Und während Max Piccolomini sich noch selbstmörderisch in einen aussichtslosen Kampf gegen die Schweden stürzt und fällt, ist es der Hals über Kopf in die Lucinde verschossene Julius, der in den verheißungsvollen Kampf der Liebe aufbricht, den Müßiggang als das eigentliche Prinzip des Adels zelebriert, nicht dem Krieg, sondern der Lust erliegt, getreu dem Motto: »Wenn die Welt auch eben nicht die beste oder die nützlichste sein mag, so weiß ich doch, sie ist die schönste«.
Für die einen gilt der Roman als »ästhetisches Ungeheuer«. Die anderen feiern ihn für seinen formalen und sprachlichen Innovationsreichtum; Schlegel dokumentiere die ästhetischen und moralischen Erschütterungen der Zeit und ziehe mit einer nie zuvor dagewesenen Formenvielfalt, einem nie zuvor dagewesenen Witz gegen sie zu Felde. Es ist Caroline, die ganz aufgeregt ist, als sie Novalis von ihren ersten Leseeindrücken berichtet, ihm die »Lucinde« ankündigt. Womit soll man diesen Roman schon vergleichen? Die Romane von Jean Paul fallen ihr ein, vielleicht, aber mit Jean Paul ist es nun wieder auch nicht zu vergleichen, mit Jean Paul ist im Übrigen gar nichts zu vergleichen, und, ach: »Es ist weit phantastischer, als wir uns eingebildet haben«. Selbst Fichte hat, wie Caroline letztens im Gespräch von seiner etwas sehr prüden Frau Johanne erfahren hat, den Roman schon dreimal gelesen. Mit jedem Mal sei er besser geworden. Und er wolle ihn noch mal lesen, von Anfang an, noch mal und noch mal.
Was kommt nicht alles zusammen in der »Lucinde«: Briefe, Dialoge, Aphorismen, Tagebucheinträge. Es geht um Liebe, über diese verrückte, so ganz andere Zeitordnung, die die penible Zeit des moralischen Gesetzes kurzerhand austrickst, hinter sich lässt, in der ästhetischen Anschauung flugs überwindet, ja, selbst in der Entfernung voneinander beziehungsweise gerade da, im Moment des Traums, der Phantasie, der Imagination, gelenkt durch die Einbildungkraft, die Gegenwart in der Gegenwart aufhebt. Die Konsequenzen, die Julius, Schlegels Protagonist, daraus zieht, sind so radikal, wie sie nur radikal sein können: »Ich kann nicht mehr sagen, meine Liebe oder deine Liebe; beide sind sich gleich und vollkommen Eins, so viel Liebe als Gegenliebe«. Geschlechterverhältnisse werden umgekehrt, die Polarität von Mann und Frau als Unvereinbare gilt nicht länger. Überladene Weiblichkeit wie übertriebene Männlichkeit – für Fritz ist beides gleich einseitig, gleich langweilig, gleich rückwärtsgewandt. Rollentausch. Die Geschlechter sollen sich wechselseitig ergänzen, um daraus ein Geschlecht zu bilden: das menschliche Geschlecht, ein anderes gibt es nicht. Nichts mehr von der herrschsüchtigen Ungestümmheit des Mannes und der selbstlosen Hingabe der Frau. Alles Bilder. Die Geschlechter sollen zu einer ›höheren Menschlichkeit‹ verschmelzen. Mit der Vorstellung von einer bürgerlichen Ehe, geordneten Verhältnisse, einem geregeleten Auskommen, von Anstand, Treue und Moral hat all das nichts zu tun. Es steht ihr aber auch nicht entgegen. Im Gegenteil: Leidenschaft und Verbindlichkeit sind gar keine echten Gegensätze; sie sind es so lange nicht, wie man das eine immer in Wechselbeziehung aufs andere betrachtet.
Ein höheres Dritte, das als Vereinigungsprinzip zwischen den Entgegengesetzten vermitteln soll, diese Denkfigur gilt in der »Lucinde« nicht für die Liebe und das Geschlechterverhältnis, sondern auch für den Roman als literarische Gattung. Man kann nicht mehr sagen, mein Text oder dein Text; beide sind sich gleich selbstständig und vollkommen Eins, so viel Text als Gegentext. Die Folge von diesem ausgeklügelten Spiel, das Fritz mit seinem Schrieben und seinen Lesern treibt: eine unendliche Verwirrung. Genitiv-Kaskade, die sich an Genitiv-Kaskade reiht, ein Spiegel, der unendlich weit in die Tiefe des Textes führt, ein Roman, der sich im Grunde selber enthält – der Roman eines Romans des Romans. Genau das ist Schlegels literarische Strategie, weil sie etwas Wesentliches über die Wirklichkeit verrät: Auch die Wirklichkeit ist oft nicht so eindeutig, wie man immer zu glauben meint, auch sie geht manchmal auf in ein Flimmern, ein hochfrequentes Oszillieren zwischen den Extremen, das nicht zum Stillstand kommt. Schon zu Beginn der »Lucinde« ist zu lesen, dass die Formen ab jetzt biegsam zu sein hätten, so biegsam, wie der Stoff in umgekehrter Weise unbeugsam zu sein hätte, immer wieder von neuem anzueignen sei. Chaos, das übergeht in Ordnung. Ordnung, die übergeht in Chaos. Beides, Form und Stoff, sieht Fritz in einer progressiven Wechselspannung begriffen, unaufhörlich im Wandel.
Die »Lucinde« sprengt die literarischen Gattungen von innen auf, macht Gebrauch von dem »unbezweifelten Verwirrungsrecht«, greift nach dem »schönsten Chaos« und verschafft sich so eine Gegenwart, die überhaupt erst in der Zukunft von sich als leider dann schon vergangener Gegenwart wissen wird. Dass der Roman durchaus auch autobiografische Züge trägt, man in Julius ohne Weiteres Friedrich, in Lucinde ohne Weiteres Dorothea wiedererkennen kann oder gar Caroline, gerät da fast zu einer Nebensache. Es geht nicht um eine Beglaubigung des Geschriebenen durch die Wirklichkeit, sondern um eine Durchdringung der Wirklichkeit durch das Geschriebene. Der Gegenwind aus dem satten, dem braven Berlin bleibt nicht aus. Der Roman ist ein Fremdkörper, hat etwas verstörendes, völlig fremdes an sich, das in die Sittsamkeit des Berliner Salonlebens einzudringen versucht. Die »Deutsche Litteratur« ist noch lange nicht in dem revolutionären Zustand, in dem Fritz sie gerne hätte. Fritz, Wilhelm, Tieck und Schelling sind noch lange nicht die Bergpartei, als die sie sich gerne sähen. Auch Dorothea und Caroline merken das, während sie eifrig korrespondieren. Sie versuchen im feuilletonistischen Kampf um die Deutungshoheit Fritz nach Kräften zu unterstützen. Vielleicht hätte der Roman auch gar nicht gedruckt werden müssen. Zumindest nicht in dieser Zeit. In fünfzig Jahren, da könnte er vielleicht gedruckt, gelesen werden als einen Roman, der vor fünfzig Jahren erschienen wäre. Fritz ist seiner Zeit unrettbar weit vorausgeeilt. Er weiß es selber. So benimmt sich nur ein Zeit, die dem Untergang geweiht ist; obwohl sie doch so viel auf ihre Kritikfähigkeit hält. Die Heftigkeit, mit der ihm der Gegenwind ins Gesicht bläst, beweist ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und doch lässt ihn das Gefühl nicht los, er müsse über dem zweiten Teil des Romans seinen Kopf verlieren.
/ / / / /
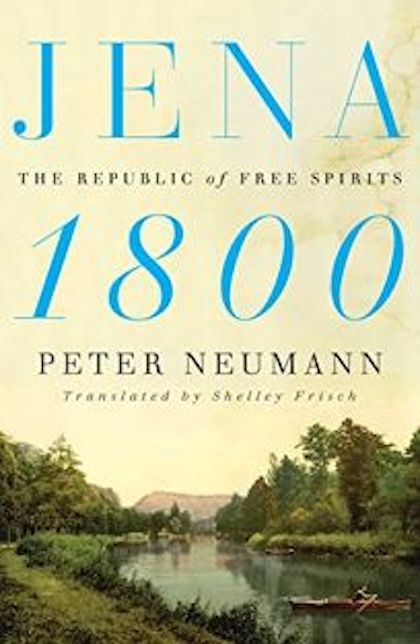 Excerpted from JENA 1800: The Republic of Free Spirits by Peter Neumann. Published by Farrar, Straus and Giroux. Copyright © 2018 by Peter Neumann and Siedler Verlag, Munich. Published in arrangement with Michael Gaeb Literary Agency, Berlin. Translation copyright © 2022 by Shelley Frisch. All rights reserved.
Excerpted from JENA 1800: The Republic of Free Spirits by Peter Neumann. Published by Farrar, Straus and Giroux. Copyright © 2018 by Peter Neumann and Siedler Verlag, Munich. Published in arrangement with Michael Gaeb Literary Agency, Berlin. Translation copyright © 2022 by Shelley Frisch. All rights reserved.